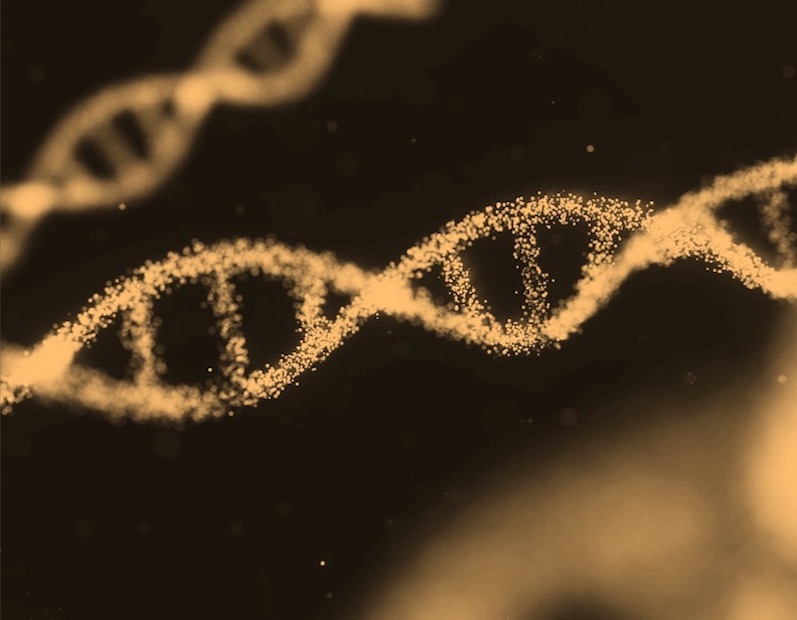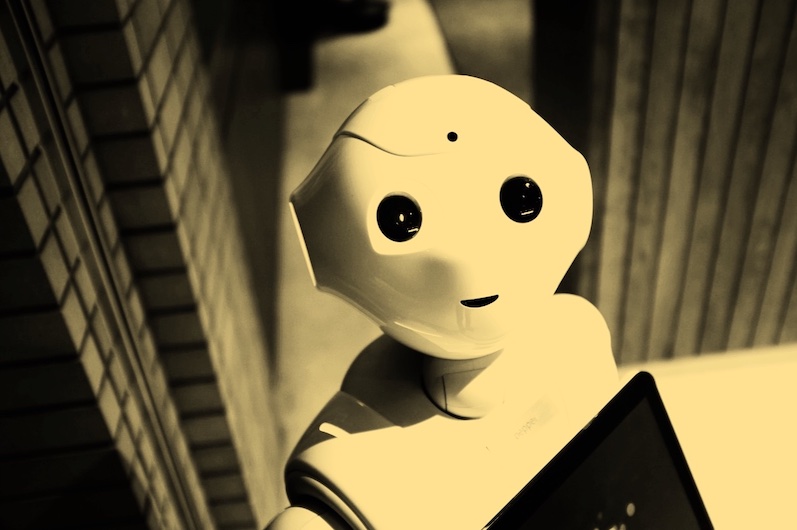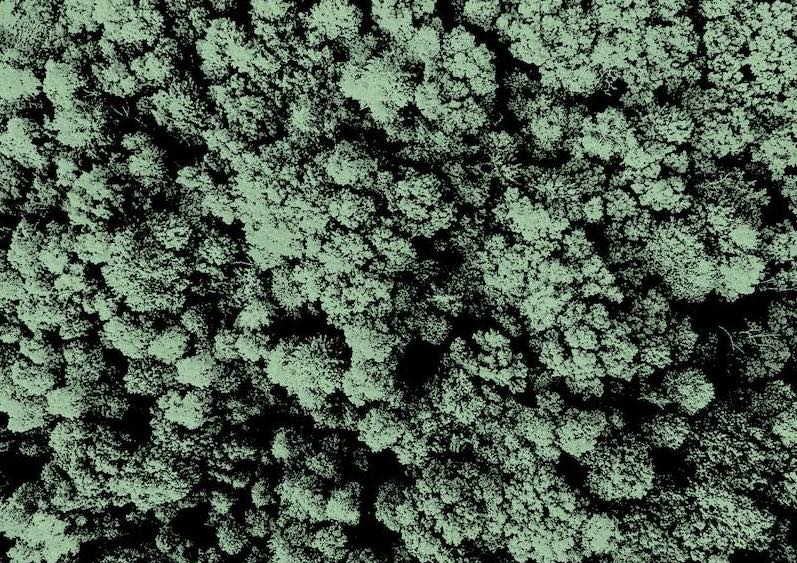What is it about?
Schmuck ist ein Faszinosum. Ich denke, da spreche ich nicht nur für mich alleine. Und inzwischen bin ich sicher, es ist auch nicht möglich, sich dem Phänomen Schmuck im Mittelalter im Alleingang zu nähern. Aus dieser Überzeugung entstand der Wunsch, dessen Erforschung breiter anzulegen und ein möglichst vollständiges Spektrum jener mediävistischen Disziplinen zusammenzustellen, die sich – zu oft ohne Berührung miteinander – damit beschäftigen, von der Archäologie über die Realienkunde, von den Literatur-, Kultur- und Geschichtswissenschaften bis hin zur Kunstgeschichte und Theologie. Selbstverständlich gibt es eine ganze Reihe weiterer Disziplinen, die es verdienten, Aufnahme in diesen Katalog zu finden, aber der Raum ist begrenzt und zwingt in diesem Rahmen zur Bescheidenheit im Anspruch. Bei aller Interdisziplinarität vermag diese kleine Artikelsammlung deshalb niemals die gesamte Welt des Schmucks im Mittelalter zu umreissen. Die Überlieferungslage ist fragmentarisch: Zu viele Objekte und Textzeugnisse haben die Jahrhunderte erst gar nicht überlebt oder es bis heute nicht ins Zentrum des Interesses geschafft. Mit diesem Verlust müssen wir alle leben. Und die Forschung ist – häufig konzentriert auf punktuelle Studien– noch weit von einer vollständigen Übersicht und Interpretation des tatsächlich Überlieferten entfernt. Nichtsdestoweniger ist uns – und damit meine ich die Verfasserinnen und Verfasser der neun hier versammelten Studien – ein erstes Rundum-Panorama gelungen, das zwar einerseits die bestehenden Lücken erst betonen mag, aber andererseits doch aussagekräftige Schlaglichter auf die zentralen Fragen wirft und so – das ist unsere Hoffnung – zu weiteren Forschungen inspirieren möge. Den Anfang bilden zwei Grundlagen-Artikel mit einer Inventur der Schmuckstücke und einer Darstellung der Berufswelt des Goldschmieds. Sie skizzieren das Panorama der Gegenstände und ein Portrait der Menschen, die diese geschaffen haben; Kunstwerke, um die es dann im Detail in den folgenden Beiträgen ‚echter’ Goldschmiedemeister geht. Stefan KRABATH widmet sich dem „Schmuck im Mittelalter“ und seinen „Grundlegende[n] Formen in ihrer Entwicklung vornehmlich aus archäologischer Sicht“. Aufgrund archäologischer Quellen zeichnet er die Entwicklung von Körper- und Trachtschmuck vom 10. bis zum Beginn des 16. Jahrhunderts nach. Im Einzelnen werden aussagefähige Typen von Fingerringen, Ohrringen, Spangen, Kronen, Ketten, Fibeln, Knöpfen, Haken- und Ösenverschlüssen, Gürteln und Abzeichen vorgestellt. Und es ist wirklich unglaublich, wie viele dieser Schmuckobjekte uns in den folgenden Studien in der einen oder anderen Form wiederbegegnen werden: Als historische und literarische, aber auch als von Goldschmiedemeistern gefertigte Objekte in deren von Elisabeth VAVRA unter dem Motto Ich Goldtschmid mach köstliche ding evozierten Berufswelt. Davon ausgehend, dass die Erzeugnisse der Gold- und Silberschmiede zu den wichtigsten Repräsentationsmitteln im öffentlichen Leben gehörten, erläutert sie die Herstellung dieser Produkte und deren Produktionsbedingungen. Sie geht der Goldschmiedekunst als Handwerk mit allen mittelalterlichen Implikationen, wie zum Beispiel dem Zunftzwang, nach. Wir verfolgen den harten Ausbildungsweg in ein Kunsthandwerk, von dem uns meist nur das Endprodukt gegenwärtig ist, von der Lehre über die Gesellen bis – im Glücksfall, denn nur wenige erreichten dieses Ausbildungsziel – zur Meisterschaft. Und selbst als Meister mit unbestritten hohem Sozialprestige unterlagen Goldschmiede strengen Zwängen und wurde ihre Arbeit – ungeachtet ihres künstlerischen Werts – oft weit geringer geschätzt als der Materialwert der darin verarbeiteten Luxusprodukte wie Gold, Silber und Edelsteine. Dieser hohe Materialwert ist auch eine der Ursachen, die zu den hohen Verlusten an mittelalterlichen Schmuckobjekten geführt haben: Es ist die Regel, dass Schmuckstücke, waren sie aus der Mode gekommen, eingeschmolzen und neben den Edelmetallen kostbare Einzelteile – wie Emailbilder oder Edelsteine – recycelt wurden. Und so stehen wir, wenn wir ein mittelalterliches Schmuckstück bewundern, häufig entweder vor unbearbeiteten Fundstücken aus Depotfunden, die wir den Archäologen verdanken oder vor Prunkstücken, die schon ab dem Mittelalter einer – oft mehrfachen – grundlegenenden Überarbeitung unterzogen wurden, so dass ihre ursprüngliche Form oft kaum mehr nachvollziehbar ist. Diese beiden Situationen spiegeln sich in den beiden punktuellen Beiträgen, die überlieferte Schmuckstücke aus der Sicht des Goldschmieds betrachten. Einer der faszinierendsten Schmuckfunde aus dem 19. und 20. Jahrhundert ist zweifelsohne derjenige, mit dem sich Jochem WOLTERS mit seinen konkreten „Goldschmiedetechnische[n] Beobachtungen am sogenannten ‚Giselaschmuck’“ befasst. Seine Präsentation eines der mit über zwanzig Einzelstücken wichtigsten bekannten Zeugnisse mittelalterlichen Goldschmucks umfasst – mit dem Fokus auf einem der brillantesten Schmuckstücke des Mittelalters überhaupt, der großen Fibel, – nicht nur eine vollständige tabellarische Übersicht von dessen goldschmiedetechnischen Charakteristika, sondern bestätigt darüber hinaus, da wir selbst bei einem so umfassenden Fund weit von der Vollständigkeit entfernt sind, auch eindrucksvoll die Überlieferungslage. Das hierfür erstelllte Glossar bietet zudem über den Beitrag hinaus eine Klärung der gemeinsamen Fachsprache für die Fortsetzung der interdisziplinären Diskussion. Während auch der sogenannte „Giselaschmuck“ schon einzelne Beispiele späterer Umarbeitungen älterer Schmuckstücke – bis ins 19. Jahrhundert hinein – aufweist, ist das Phänomen des ‚Recyclings’ für das Untersuchungsobjekt von Erhard BREPOHL, „Die deutsche Reichskrone“ als „ein Meisterwerk der Goldschmiedekunst“, besonders charakteristisch. Nach vielen Jahren der Beschäftigung mit der Krone deutet er dieses typische ‚Recyclingobjekt’ aus einer ganz eigenen Perspektive. Es mag sein, dass seine sich vor dem aktuellen Forschungsstand stark kontrastierend abzeichnenden Hypothesen bisweilen gewagt erscheinen, sie zeigen jedoch eindrücklich, wie schwer es ist, aus aktueller Perspektive mit der scheinbar so ‚sorglosen’ Weiterverarbeitung von Versatzstücken aus vergangenen und für uns verlorenen Objekten durch mittelalterliche Kunsthandwerker umzugehen. Sein Versuch der Erklärung des aktuellen Zustands der Reichskrone aus der Perspektive des modernen Goldschmieds, der sich vor allem über das „Wie?“ der Verwandlung eines alten Kunstobjekts in ein neues Gedanken macht, vergegenwärtigt uns die Grenzen rein historisch-symbolischer Interpretationen und birgt dadurch sicherlich viel interdisziplinären Diskussionsstoff. Ich stelle mir sehr gut vor, wie seine Evokation Heinrichs II. eine wissenschaftliche Sichtung der erhaltenen bildlichen Darstellungen des Herrschers in den Handschriften anregen und Geschichtswissenschaftler zu einer spannenden Suche nach dem historischen Anlass für die Zerstörung des Orphanus-Opals durch einen gewaltigen Schlag auf die Krone inspirieren könnte. Vom Orphanus-Opal zu den Edelsteinen und zum heute prestigeträchtigsten unter ihnen ist es nur ein Schritt. Ihn geht Horst SCHNEIDER mit seiner umfassenden Sichtung der Tradition und Stellung der „Diamanten im Mittelalter“. Er zeigt eindrucksvoll, wie der Diamant im Mittelalter zu seiner hohen Wertschätzung kam, und zwar zunächst nicht als Schmuckstein, sondern zum Einen profan als ‚Werkzeug’ der Steinschneider und zum Anderen, vor allem aufgrund seiner legendären magischen Kraft der Unbezwingbarkeit, als Mythos der Unzerstörbarkeit. Eines seiner auch für die literatur- und kulturwissenschaftliche Betrachtung interessanten Ergebnisse ist daher, dass der Diamant, ermöglicht durch die Einführung des Diamantschliffs, erst am Ende des Mittelalters bzw. zu Beginn der Neuzeit auch als Schmuckstein an Bedeutung gewann, weshalb wir ihm auch erst im letzten Beitrag des Bandes, in dem sich Renate PROCHNO-SCHINKEL dem Spätmittelalter zuwendet, wiederbegegnen werden. Diese Geringschätzung des Diamanten im Mittelalter, wie sie auch aus manchen Lapidarien hervorgeht, wo der Diamant erst Platz 17 einnimmt, während ihm Edelsteine wie Rubin, Smaragd oder Saphir den Rang ablaufen, erklärt auch seine völlige Abwesenheit in den Schmuckstücken der Artusliteratur, mit denen ich mich – wie eingangs angekündigt un retour à mes premiers amours – mit einem romanistisch-kulturwissenschaftlichen Blick auf Chrétien de Troyes‘ Romane auseinandersetze. Auch aus dieser Perspektive eröffnet der Band sicher interessante Perspektiven in die übrigen hier im Interesse der Interdisziplinarität leider zu kurz gekommenen weiteren Philologien. Im Bereich der Altgermanistik könnte hier zum Beispiel an eine Studie von Ulrich ENGELEN zu den ‚Edelsteine[n] in der deutschen Dichtung des 12. und 13. Jahrhunderts’ (Münster 1973) oder an die Grundlagenstudien britischer Forscher wie Ronald W. LIGHTBOWN mit der auf das Victoria and Albert Museum konzentierten Studie zur ‚Mediaeval European Jewellery’ (London 1992) oder Marian CAMPBELLS ‚Medieval jewellery in Europe 1100 – 1500’ (London 2009) repräsentieren – angeknüpft werden. Wie sehr Schmuck selbst den mittelalterlichen (Kirchen-)Alltag (mit-)bestimmte, zeigt Wendelin KNOCH mit seinen Überlegungen zu „Heilige[m] Schmuck und benediktinische[m] Ordensideal“, in denen er „Kontroversen und Klärungen im Umfeld von Hildegard von Bingen (†1179) und Bernhard von Clairvaux (†1153)“ schildert, die aber weit darüber hinaus in die Schmuck-Methaphorik der Bibel zum einen und in die die Alltagskultur der Präsenz von Schmuck auch im Inneren der Klöster reichen. Der kirchenintern zum Stein des Anstoßes gewordene festtägliche Schmuck des Konventes Hildegards von Bingen macht aber auch klar, dass dieser Schmuck nicht einfach „schön“ ist, sondern ausstrahlt, was die – ausnahmslos reichen – Trägerinnen als Nonnen auszeichnet: Vornehme adlige Damen, wie wir sie zum Beispiel von den Mosaiken Ravennas kennen, konnten sich auch als Bräute Christi sehr wohl im vollen Brautschmuck ihres Standes präsentieren. Und damit sind wir bei der Frage nach den Trägern und Trägerinnen mittelalterlichen Schmucks angelangt. Selbstverständlich war Schmuck Ausdruck eines privilegierten Standes und besonderen Reichtums, aber das – zumindest erwecken die überlieferten Schmuckstücke und deren Schilderungen in der Literatur gleichermaßen den Eindruck – zunächst geschlechterübergreifend. Nichtsdestotrotz drängt sich natürlich beim Thema Schmuck im Mittelalter die Frage nach jenen geschlechterspezifischen Charakteristika auf, denen Amalie FÖßEL unter dem Motto „Dividitur autem et haec in mares feminasque“ zum „Geschlecht der Steine“ nachgeht. Sie schlägt einen weiten Bogen vom ‚Geschlecht’ der Edelsteine in den antiken Lapidarien und bei Isidor von Sevilla bis hin zu deren Rezeption, Ausweitung und Variation im Mittelalter und von den Geschlechterbezügen in der Steinallegorese des Mittelalters zum konkreten Gebrauch von Schmuck und Edelsteinen aus genderspezifischer Perspektive. Ihre sowohl im Zusammenhang mit den theologischen Reflexionen Wendelin KNOCHS zum „Heiligen Schmuck“ als auch – über den „Edelstein-Vergleich im Mittelalter“ zur Edelstein-Metaphorik Chrétien de Troyes‘ in dessen Hommage an Marie de Champagne in meinem eigenen Beitrag stehenden Überlegungen knüpfen zudem ein enges Netz, das das Interesse unseres gemeinsamen interdisziplinären Ansatzes direkt intertextuell belegt. Amalie FÖßELS Quellen weisen bereits teilweise den Weg ins späte Mittelalter, den Renate PROCHNO-SCHINKEL mit ihrem Blick auf den „Schmuck in Burgund, Flandern und Frankreich unter den Valois-Herzögen (1364 – 1477)“ konsequent fortsetzt. Auch sie beklagt die zum Teil problematische Überleiferungslage sowie die fehlende systematische Auswertung literarischer Quellen. In einem ersten Schritt liefert sie einen – durchaus für die gesamte Artkelsammlung übergreifend dienlichen – Forschungsüberblick, bevor sie sich den Quellen zuwendet und anschließend Fallstudien, so zur symbolischen und ästhetischen Rolle von Rubinen und Schmuckstücken, besonders Ringen mit Rubinen im Untersuchungszeitraum. Als weiteres Forschunsdesiderat weist Renate PROCHNO-SCHINKEL auf die noch ausstehende ikonographische Gesamtwürdigung des Schmucks, dessen heraldische Symbolik zum einen und dessen lange Traditionen zum anderen, hin. Selbstverständlich steht ihr in diesem Rahmen nur Raum für einige wenige charakteristische Beispiele zur Verfügung, bei denen jedoch die Konzentration auf christliche Themen und das besondere Fehlen ikonographischer Traditionen antiker Provenienz, aber auch mittelalterlicher Stoffe auffällt. Sie vermag nichtsdestoweniger damit gleichzeitig eine Tür zwischen der Schmuckkunst und anderen Medien der Kunst, insbesondere der Bildhauerei und ein Fenster in die Zukunft zu öffnen.
Featured Image

Photo by Edouard Dognin on Unsplash
Why is it important?
Schmuck ist ein Faszinosum. Ich denke, da spreche ich nicht nur für mich alleine. Und inzwischen bin ich sicher, es ist auch nicht möglich, sich dem Phänomen Schmuck im Mittelalter im Alleingang zu nähern. Aus dieser Überzeugung entstand der Wunsch, dessen Erforschung breiter anzulegen und ein möglichst vollständiges Spektrum jener mediävistischen Disziplinen zusammenzustellen, die sich – zu oft ohne Berührung miteinander – damit beschäftigen, von der Archäologie über die Realienkunde, von den Literatur-, Kultur- und Geschichtswissenschaften bis hin zur Kunstgeschichte und Theologie. Selbstverständlich gibt es eine ganze Reihe weiterer Disziplinen, die es verdienten, Aufnahme in diesen Katalog zu finden, aber der Raum ist begrenzt und zwingt in diesem Rahmen zur Bescheidenheit im Anspruch.
Perspectives
Mir – auch im Interesse der Vorlagen, die alle Mitautoren dieser Sammlung lieferten – eine fruchtbare Fortsetzung dieser Forschungen in unserem interdisziplinären Ansatz zu wünschen bleibt mein Anliegen für diese Zukunft.
Prof. Dr. Angelica Rieger
RWTH Aachen University
Read the Original
This page is a summary of: Einleitung, Das Mittelalter, January 2016, De Gruyter,
DOI: 10.1515/mial-2016-0014.
You can read the full text:
Contributors
The following have contributed to this page